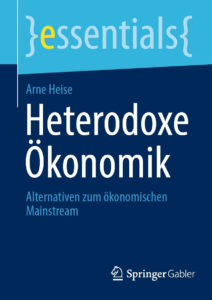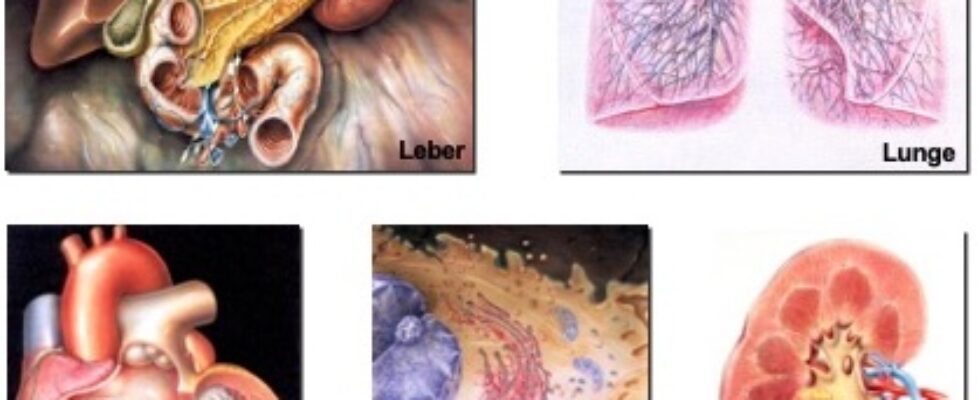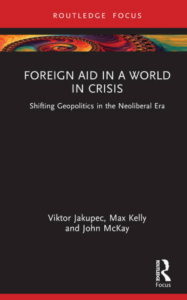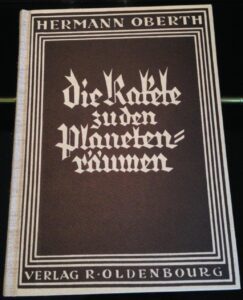Band 158 der Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät jetzt verfügbar
Band 158/2023 der Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät ist jetzt verfügbar
verfügbar
Die Energiewende 2.0
Im Fokus: die Stoffwirtschaft
Kolloquium des Arbeitskreises
“Energie, Mensch und Zivilisation” am 9. Juni 2023
Herausgegeben von
Herausgegeben von
Herausgegeben von Gerhard Pfaff, Norbert Mertzsch, Ernst-Peter Jeremias
Mit Beiträgen von Ulrike Alewell, Gerhard Banse, Ingo Bruch, Henry Gnorski, Andreas Hahn, Ernst-Peter Jeremias, Angela Kruth, Norbert Mertzsch, Gerhard Pfaff, Katrin Rübner, Alexander Schnell, Gundula Schumann, Ulrich Schwarz, Julia Seher, Kasra Shafiei, Manuel Vöge
Publikationen – Sitzungsberichte


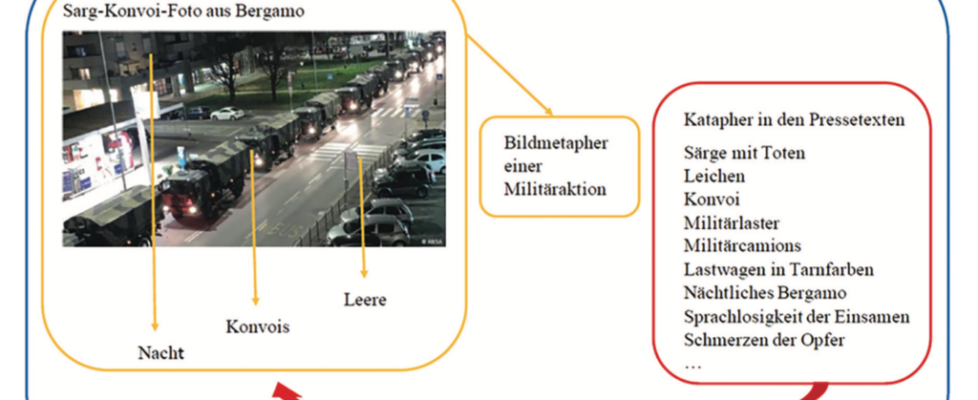




 Prof. Dr. Gerhard Pfaff obtained his Ph.D. in inorganic chemistry from the University Jena, worked many years for the Merck KGaA as head of R&D Pigments and is teaching at the Technical University Darmstadt. He is author of more than 200 scientific publications and member of the Leibniz Society of Sciences in Berlin.
Prof. Dr. Gerhard Pfaff obtained his Ph.D. in inorganic chemistry from the University Jena, worked many years for the Merck KGaA as head of R&D Pigments and is teaching at the Technical University Darmstadt. He is author of more than 200 scientific publications and member of the Leibniz Society of Sciences in Berlin.