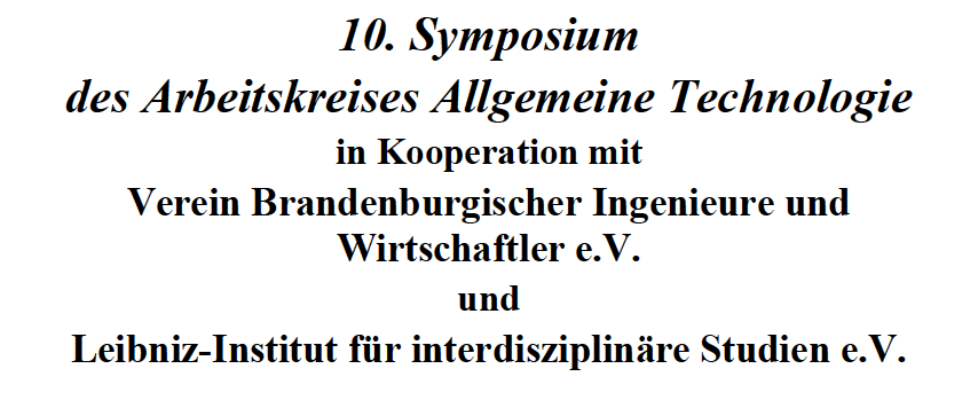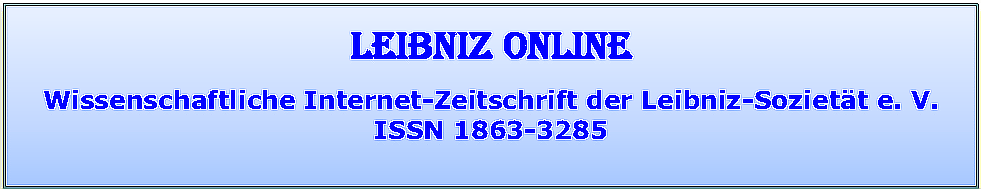Band 158 der Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät jetzt verfügbar
Band 158/2023 der Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät ist jetzt verfügbar
verfügbar
Die Energiewende 2.0
Im Fokus: die Stoffwirtschaft
Kolloquium des Arbeitskreises
“Energie, Mensch und Zivilisation” am 9. Juni 2023
Herausgegeben von
Herausgegeben von
Herausgegeben von Gerhard Pfaff, Norbert Mertzsch, Ernst-Peter Jeremias
Mit Beiträgen von Ulrike Alewell, Gerhard Banse, Ingo Bruch, Henry Gnorski, Andreas Hahn, Ernst-Peter Jeremias, Angela Kruth, Norbert Mertzsch, Gerhard Pfaff, Katrin Rübner, Alexander Schnell, Gundula Schumann, Ulrich Schwarz, Julia Seher, Kasra Shafiei, Manuel Vöge
Publikationen – Sitzungsberichte