Nachruf auf unser Mitglied Prof. Dr. Reinhard Mocek
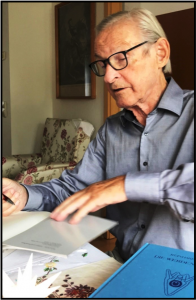
(Foto: Dr. Rowena Lanfermann, Dessau)
Die Leibniz-Sozietät der Wissenschaften trauert um ihr Mitglied, den Wissenschaftshistoriker Prof. Dr. Reinhard Mocek, der am 31. August 2021 im Alter von 84 Jahren verstorben ist.
Reinhard Mocek, der ein langes Forscherleben hindurch das weite Feld der Wissenschaftsreflexion zwischen Philosophie und Geschichte, Theorie und Politik unermüdlich und mit reichem Ertrag bestellte, hat seinen fünfundachtzigsten Geburtstag am 12.11.2021 nicht mehr erleben dürfen. Er fehlt uns schmerzlich, und wir sehen uns auf sein umfangreiches, thematisch ungemein vielfältiges Opus verwiesen, das nie zu klassischer Abgeschlossenheit tendierte, sondern in seiner offenen, dialogorientierten und dialogsuchenden Anlage von vornherein dazu bestimmt war, in die Zukunft hinein zu wirken. Auf den Punkt bringen lässt sich die unikale Art und Weise, wie er die Wissenschaft sah und wie er sie in mannigfachen Façetten unter immer wieder neuen Perspektiven zum Gegenstand seiner Untersuchungen machte, vielleicht am besten mit dem Wort „Neugier“ (curiositas), das er aus der Umgangssprache aufnahm und zum heimlichen Zentralbegriff seines kategorialen Kosmos ausformte (Neugier und Nutzen. Blicke in die Wissenschaftsgeschichte, 1988). In ihrem anthropologischen Kern war Wissenschaft für ihn institutionalisierte Neugier, die stets mit dem Unvorhersehbaren rechnet und ihren äußeren Daseins- und Rahmenbedingungen widerständig gegenübertritt, wenngleich sie sich auf eben diese einlassen muss, um ihr humanes Potenzial zu entbinden und gesellschaftlich wirksam zu werden.
Natürlich übersah Mocek nicht, dass die wissenschaftliche Neugier in einem unentrinnbaren Bezug zur praktischen Nützlichkeit ihrer Resultate steht, doch er verwahrte sich gegen das in den Industrie- und Technologiegesellschaften des letzten Halbjahrhunderts – keineswegs nur in denen des Ostens – allgegenwärtige und bis zum Überdruss wiederholte Mantra vom wissenschaftspolitischen und forschungsorganisatorischen Primat der Nutzenserwartungen, und es ist ebenso spannend wie vergnüglich, in seinen Texten nachzulesen, wie listig und finessenreich er dabei vorging. Der Reiz dieser Texte liegt nicht zuletzt in ihrer lebendigen Sprache, die sich den gängigen Normierungen weitestgehend entzog und deshalb für die in der philosophischen Szene der DDR verbreiteten ideologischen Beckmessereien kaum angreifbar war.
Für ihn war es ein großes Glück, in seinen jungen Jahren als Student und als Doktorand am Philosophischen Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig Persönlichkeiten zu begegnen, denen der Gestus des Belehrenwollens fernlag und die ihm jenes lebendige Verhältnis zur Wissenschaft nahebrachten, das er dann ein Leben lang selbst kultivierte. Drei von ihnen seien hier in Erinnerung gerufen: Ernst Bloch, dessen legendäre Vorlesungen er noch hören konnte; der Physiker-Philosoph Klaus Zweiling, der bei Max Born promoviert hatte; und der früh verstorbene Wissenschaftshistoriker Gerhard Harig, der das KZ Buchenwald überlebt hatte und von dem er sich anregen ließ, Wissenschaftsgeschichte nicht im engen disziplinhistorischen Gehäuse, sondern mit einem weiten kulturellen, philosophischen und gesellschaftswissenschaftlichen Horizont zu betreiben.
Mit dieser soliden Mitgift ausgestattet, wandte er sich, während er stets in philosophischen Beschäftigungsverhältnissen tätig war, mit ganzem Herzen und mit einem guten Teil seiner Kraft der Biologiegeschichte zu, die zu seiner bevorzugten Referenzwissenschaft wurde und es immer blieb. Die Wurzeln dieser Neigung gehen schon auf seine Leipziger Studienzeit zurück, für die wissenschaftliche Öffentlichkeit wurde sie spätestens mit seiner 1965 verteidigten Dissertation sichtbar (Philosophische und wissenschaftshistorische Aspekte der Entwicklungsmechanik). So weit er in den folgenden Jahrzehnten in seinen Forschungen thematisch auch ausgriff – zur Geschichte der Biologie kehrte er immer wieder zurück und bereicherte sie sukzessiv mit einer Serie eindrucksvoller Studien und Monographien. Sie war ihm ein Kraftquell, in den er eintauchen konnte, wenn ihn der Umgang mit philosophischen Abstraktionen ermüdet hatte und er neuer Anregung bedurfte, ein Ort der intellektuellen Erfrischung und der Entdeckerfreude.
Mit der Dissertation hatte er auch bereits seinen ganz besonderen biologiehistorischen Schwerpunkt gesetzt, bei dessen Erkundung er ins Detail und in die Tiefe ging und zu einer international anerkannten und gesuchten Autorität wurde – die Geschichte der kausalen Morphologie (mit einer älteren Bezeichnung auch: Entwicklungsmechanik): jenes Aspekts der Biologie, der die Formwerdung der Organismen in den Blick nimmt. Über eine Serie von Detailstudien arbeitete er sich gegen Ende der 1990er Jahre zu einer großen Synthese vor: Die werdende Form. Eine Geschichte der kausalen Morphologie (1998). Die „werdende Form“ ist neben der „Neugier“ eine weitere wesentliche Signatur seiner persönlichen Forschungsperspektive. Überall – weit über die Biologie hinaus – waren es Phänomene der Kreativität, der Emergenz, der Selbstorganisation, die ihn vor allem faszinierten. Der Titel der ihm zu seinem Achtzigsten gewidmeten Festschrift (formendes LEBEN. FORMEN des Lebens. Philosophie – Wissenschaft – Gesellschaft, 2016) – einer wissenschaftlichen, sprachlichen und buchkünstlerischen Preziose – spielt geist- und beziehungsreich auf die Zentralität dieses Motivs in seinem Denken und Schaffen an.
Vorzugsweise durch diese Optik sah er die Wissenschaft, wann immer er sie als Philosoph, als Theoretiker oder als Historiker – und diese Perspektiven waren bei ihm nie getrennt, sondern durchdrangen einander – zum Gegenstand seiner Reflexionen und Untersuchungen machte. Sie interessierte ihn weitaus mehr unter dem Aspekt des Werdens als unter dem des Gewordenseins, und das Werden von Erkenntnis erschien ihm als ein offener, selbstorganisierender, durch die Gesamtheit seiner Bedingungen von den institutionellen Fundamenten bis zu den leitenden Paradigmen stets nur partiell determinierter, gerade durch seine unerwarteten und überraschenden Züge wesentlicher Prozess. Deshalb wandte sich Reinhard Mocek immer wieder jenem Focus zu, in dem sich alle Strukturen und Verhältnisse, die auf das Forschen Einfluss nehmen, kreuzen und miteinander verbinden, und in dem das Erkennen am intimsten und konkretesten nachvollziehbar ist: der biographisch adressierten Wissenschaftlerpersönlichkeit in ihrer Einzigartigkeit – gerade unter den Voraussetzungen von big science. Nicht zuletzt dürfte diese Präferenz auch als ein bewusst gesetzter Kontrapunkt zur zeitgenössischen Apotheose von „Großforschung“ zu verstehen sein.
Während die sich ab 1969/70 in der DDR entwickelnden großen Institutionen der Wissenschaftsforschung die Wissenschaft vor allem auf ihrer Makroebene als ein dynamisch wachsendes gesellschaftliches Subsystem im Blick hatten, blieb der individualisierende Akzent ein Markenzeichen jener Variante der Wissenschaftsreflexion, die in Halle beheimatet war. Reinhard Mocek gelang es, den Umstand, dass Halle wissenschaftspolitisch im Windschatten von Berlin und Leipzig lag, in einen Vorzug zu verkehren. Von ihm und seinem Kreis kamen im Wissenschaftsdiskurs der DDR häufig unkonventionelle, erfrischende Wortmeldungen, die aufhorchen ließen – meist in Gestalt von Aufsätzen, gelegentlich aber auch in der kompakteren Form von Büchern. Neben Neugier und Nutzen wäre hier dessen Vorläufer Gedanken über die Wissenschaft. Die Wissenschaft als Gegenstand der Philosophie (1980) zu nennen; damit opponierte er gegen die stärker werdende Tendenz, die Reflexion über Wissenschaft von der Philosophie abzunabeln und ihr, nunmehr als Wissenschaftsforschung (science research) etabliert, eine nichtphilosophische, nach fachdisziplinären Regulativen konstruierte Theorie zu unterlegen. So war und blieb auch auf dem Feld der generalisierten Wissenschaftsreflexion innerhalb der DDR Halle ein besonderer Ort.
Es sollte hier mitbedacht werden, dass Reinhard Mocek einen Großteil seiner Forschungen – vor allem, aber keinesfalls allein über biologiehistorische Themen – außerhalb der Agenda betrieb, auf die er von Berufs wegen verpflichtet war. Er bekleidete keine Stelle für Wissenschaftsgeschichte oder für philosophy of science, sondern war am Philosophischen Institut (später: Sektion Philosophie) der Martin-Luther-Universität (MLU) Halle zunächst Dozent, dann ab 1969 bis zur Abwicklung ordentlicher Professor für dialektischen Materialismus. Allerdings profitierte er vom generell zunehmenden Prestige der Wissenschaftsforschung insofern, als sein institutioneller Bewegungsraum in Halle sukzessiv größer wurde. 1975 schuf er einen Arbeitskreis für Wissenschaftsgeschichte an der MLU, der Vertreter zahlreicher Disziplinen vereinte und seit 1977 Arbeitsblätter zur Wissenschaftsgeschichte im Manuskriptdruck als Quasi-Periodikum („graue Literatur“) herausgab. 1980 schließlich konnte er das von ihm geleitete und in der kurzen Zeit seines Bestehens über die Grenzen der DDR hinaus at-traktive Interdisziplinäre Zentrum für Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte aus der Taufe heben. Zur Erweiterung seiner Handlungsmöglichkeiten trug schließlich auch die 1983 durch die Verleihung des Nationalpreises III. Klasse für Wissenschaft und Technik erfolgte öffentliche Anerkennung seiner Arbeit bei.
Die gesellschaftlichen Zusammenhänge der Wissenschaft verfolgte Mocek weniger in ökonomischen und politisch-institutionellen als vielmehr in philosophisch-methodologischen und weltanschaulichen Kontexten. Hier zeichnet sich ein weiterer beachtenswerter Pfad seiner Forschungen ab, den er gemeinsam mit seinem Hallenser Philosophenkollegen Dieter Bergner beschritt. Mit dem Konzept des dialektischen Materialismus, das er als Hochschullehrer gemäß der Nomenklatur seines Lehrstuhls vertrat, verbindet sich – nach verbreiteter Vorstellung – der Gestus eines ideologischen Monopolanspruchs, der alle anderen Denkschulen als „bürgerlich“ etikettiert und sein Verhältnis zu diesen ausschließend und konfrontativ auffasst. Unter den Bedingungen des Kalten Krieges trat dieser Gestus in den Vordergrund, und man könnte die erste von Bergner und Mocek gemeinsam vorgelegte Monographie (Bürgerliche Gesellschaftstheorien. Studien zu den weltanschaulichen Grundlagen und ideologischen Funktionen bürgerlicher Gesellschaftsauffassungen, 1976) auf den ersten Blick so auffassen, wenn man sich allein von der Titelformulierung leiten lässt. Ein zweiter Blick lehrt jedoch, dass die Autoren bereits hier auf gutem Weg waren, dieses ideologische Korsett zu verlassen. Die zeitgenössischen nichtmarxistischen, „bürgerlichen“ Gesellschaftstheorien wurden darin als ein plurales Ensemble unterschiedlicher Konzepte behandelt, mit viel Aufmerksamkeit dafür, was die Vertreter der einzelnen Schulen tatsächlich behaupteten und worin sie sich voneinander unterschieden.
Damit nahm ein Perspektivenwechsel seinen Anfang, der mit überraschender Intensität und Konsequenz verlief und ein Jahrzehnt später mit einer weiteren Monographie des gleichen Autorenduos besiegelt wurde (Gesellschaftstheorien. Philosophie und Lebensanspruch im Weltbild gesellschaftstheoretischen Denkens der Neuzeit, 1986). Dieses Buch knüpfte zwar an Motive der früheren Monographie an, war aber in seinem Ansatz grundsätzlich neuartig und inklusiv: Der Marxismus, als dessen Vertreter sich Bergner und Mocek nach wie vor sahen, erschien nun in erster Linie als Dialogpartner anderer Denkströmungen bei der kooperativen Suche nach einer nachhaltigen Überlebensstrategie der Menschheit. Es waren nicht in erster Linie innertheoretische Erwägungen, die diesen Wandel bewirkten; vor allem war er eine Reaktion auf das fortschreitende Bewusstwerden gravierender Existenzprobleme der Weltgesellschaft, die als zwingendes Gebot zur Kooperation und friedlichen Koevolution der konträren politischen Systeme interpretiert wurden. In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren der DDR vollzogen nicht wenige ihrer Philosophen und Gesellschaftswissenschaftler diese Wendung; Mocek zeichnete aus, dass er es besonders früh und besonders konsequent tat. In den 1980er Jahren wurde Halle – mit ihm im Mittelpunkt – zu einem Hotspot des Ost-West-Dialogs auf dem Feld der Wissenschaftsreflexion. Herausragende Vertreter dieses Gebietes aus der Bundesrepublik wie Jürgen Habermas, Wolfgang Krohn, Niklas Luhmann oder Jürgen Mittelstraß kamen nach Halle und trugen dort vor. Noch die personelle Zusammensetzung des Herausgeberteams der bereits erwähnten Festschrift zu seinem 80. Geburtstag war ein spätes Echo auf jene Kultur des Brückenschlags: Uta Eichler und Ruth Peuckert, seine einstigen Hallenser Kolleginnen, und Wolfgang Krohn, der Freund und Kollege aus Bielefeld.
Nachdem Reinhard Mocek dies alles vollbracht und damit zum Ansehen seiner Alma Mater weit über Halle hinaus nach Kräften beigetragen hatte, hielten jene, die 1990/1991 mit ihrer Erneuerung betraut waren, seinen weiteren Verbleib an seiner bisherigen Wirkungsstätte nicht mehr für tragbar; auch eine befristete Projektstelle kam nicht in Frage, von einer Professur ganz zu schweigen. Hätte er ein Jahr früher das Licht der Welt erblickt, dann wäre ihm eine bescheidene soziale Absicherung zuteil geworden; bis zum Geburtsjahrgang 1936 aber reichte das zeitweilig auf dem einstigen DDR-Territorium vergebene sogenannte Altersübergangsgeld nicht mehr. Um ein Haar wäre damit sein Wissenschaftlerdasein beendet gewesen. Zwischenzeitlich half eine befristete ABM-Stelle an dem 1991 gegründeten und vorwiegend der Geschichte Berlins gewidmeten „Luisenstädtischen Bildungsverein“. Er beteiligte sich aktiv an der Gestaltung des wissenschaftlichen Programms dieses Vereins, dokumentiert etwa in dem von ihm zusammen mit dessen Vorsitzendem Hans-Jürgen Mende herausgegebenen Band Gestörte Vernunft? Gedanken zu einer Standortbestimmung der DDR-Philosophie (1996), aber ein dauerhaft tragfähige Lösung konnte das für ihn nicht sein.
Was nun folgte, wird für immer ein Ruhmesblatt deutsch-deutscher kollegialer Solidarität bleiben. Als hätten sie einen gemeinsamen Masterplan vereinbart, holte ihn einer nach dem anderen aus der Arbeitslosigkeit – mit einem Fellowship, einer Gastprofessur, einer Projektstelle: Wolf Lepenies an das Wissenschaftskolleg am Grunewald in Berlin, Jürgen Mittelstraß an die Universität Konstanz, Wolfgang Krohn an die Universität Bielefeld und Hans-Jörg Rheinberger an das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin-Dahlem. Sie alle, sämtlich international hoch angesehene Vertreter von Philosophie und Wissenschaftsforschung, taten zur rechten Stunde das in ihrer Macht Stehende, um ihrem in Halle nicht mehr gemochten Kollegen die Fortsetzung seiner Forschungsarbeit zu ermöglichen. Wer den wissenschaftlichen Ertrag der letzten drei Lebensjahrzehnte Reinhard Moceks überschaut (Johann Christian Reil (1759 – 1813). Das Problem des Übergangs von der Spätaufklärung zur Romantik in Biologie und Medizin in Deutschland, 1995; Die werdende Form, 1998; Biologie und soziale Befreiung. Zur Geschichte des Biologismus und der Rassenhygiene in der Arbeiterbewegung, 2002; Alfred Kühn (1885 bis 1968). Ein Forscherleben, 2012), sollte auch jene nicht vergessen, die ihm dafür die unerlässlichen institutionellen Voraussetzungen schufen und ihm zudem die anregenden Milieus ihrer eigenen Einrichtungen für fortgesetzten wissenschaftlichen Austausch öffneten, dessen er mehr als viele andere bedurfte.
Die Leibniz-Sozietät versicherte sich des Talents und der Kompetenz Moceks, indem sie ihn als eines der ersten nach ihrer Konstituierung neu zugewählten Mitglieder in ihre Reihen aufnahm. In seiner kurzen Antrittsrede auf dem Leibniztag 1994 bezog er sich auf einen Zentralbegriff des Namensgebers und bemerkte: „Und fühlt man sich im Sinne Leibnizens als Monade, dann als solche in einer Gemeinschaft, die sich jedoch keineswegs gesichtslos einfügt und damit Gefahr läuft, zu einem Nichts zu werden. Die Monade, das ist der souveräne Mitträger eines souveränen Ganzen!“ Die geistige Welt, die die „Monade“ Mocek in sich trug, eröffnete sich der Gemeinschaft der Sozietät noch im gleichen Jahr, als er am 15. 12. 1994 mit einem brillanten Vortrag zum damals brandaktuellen Streitthema Die Postmoderne – intellektuelle Mode oder Kulturzeichen der Gegenwart in der Klasse Geistes- und Sozialwissenschaften seinen Einstand gab; er löste damit eine ungewöhnlich lebhafte Diskussion aus, deren überarbeitete Texte ein ganzes Heft der Sitzungsberichte füllten (SB LS 4 (1995)4).
In den späteren Jahrzehnten erlaubten es zunehmende gesundheitliche Beeinträchtigungen Reinhard Mocek kaum noch, sich Bahnfahrten zwischen Halle und Berlin zuzumuten und aktiv am wissenschaftlichen Leben der Leibniz-Sozietät teilzunehmen. Umso größere Beachtung verdient, dass eine von ihm herausgegebene kapitale, 923 Seiten umfassende Briefedition (Alfred Kühn (1885 bis 1968). Lebensbilder in Briefen, 2020) ihre Vollendung einer vertrauensvollen Kooperation innerhalb der Sozietät verdankt. Bei der Arbeit an der Biographie des Zoologen, Entwicklungsphysiologen und Genetikers Alfred Kühn war ihm dessen außergewöhnlich reichhaltige, auf eine große Zahl von Briefpartnern verteilte Korrespondenz aufgefallen, in der sich mehr als ein halbes Jahrhundert Wissenschafts- und Zeitgeschichte spiegelt. Mit einem enormen Aufwand trug er jahrelang aus zahlreichen Quellen rund 2000 Briefe von und an Kühn zusammen und transkribierte sie. Nahezu 700 davon mit fast 160 Korrespondenten wurden in die Edition aufgenommen. Hans-Jörg Rheinberger, der ein Geleitwort schrieb, nennt dieses Werk mit vollem Recht ein „editorisches Geschenk“. Unser Mitglied Ekkehard Höxtermann, Programmleiter der Basilisken-Presse im Natur + Text Verlag, in der das Werk erschienen ist, übernahm dabei weitaus mehr als die übliche verlegerische Betreuung. Bei der editorischen Kärrnerarbeit, die Mocek mit versagenden Kräften nicht mehr vollständig allein bewältigen konnte, war er ihm ein uneigennütziger Partner. Ohne seinen substantiellen Beitrag wäre Moceks biologiehistorisches Opus Magnum Fragment geblieben. Man muss das wissen, das fertige Werk gibt keinen Hinweis darauf. Besser kann die Grundidee der Sozietät – das fruchtbare Miteinander der in ihr vereinten Gelehrten – wohl kaum in die Tat umgesetzt werden.
Die ersten Rezensionen – aus Deutschland und aus der Schweiz – , die das hohe Niveau der editorischen Arbeit würdigen, sind erschienen oder im Druck, weitere werden folgen. Das Werk, mit dem sich Reinhard Mocek von der wissenschaftlichen Gemeinschaft verabschiedete, hat gerade erst begonnen, seine Wirkung zu tun.
Hubert Laitko (MLS)