Bericht über den Vortrag von Prof. Dr. Peer Pasternack im Plenum der Sozietät

Am 13. November 2015 hielt Prof. Dr. Peer Pasternak, Direktor des Instituts für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, einen Vortrag zum Thema Wissenschaftsalltag und Politik in der DDR: die Auskünfte der Belletristik. Er ging dabei von der Erkenntnis aus, dass fiktive Literatur die wahren Verhältnisse oft besser abbildet als offizielle Dokumente oder Zeitzeugenberichte. In seinem Buch Von Campus- bis Industrieliteratur. Eine literarische DDR-Wissenschaftsgeschichte (Tectum-Verlag, Baden-Baden 2024, 640 Seiten) behandelt er rund 160 belletristische Bücher, von denen 110 bis 1990 und 50 nach 1990 erschienen sind. Das Buch ist online verfügbar https://www.hof.uni-halle.de/web/dateien/pdf/DDR-Wissenschaftsbelletristik.pdf.
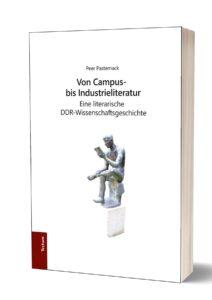 Aus seinem Buch traf Peer Pasternack im Vortrag eine Auswahl aus den chronologisch angeordneten Autoren und betonte insbesondere die Werke von Helga Königsdorf, Christoph Hein, Erik Neutsch und John Erpenbeck. Einleitend erwähnte er die ideologisierende Sprachregelung in der DDR, die Jens Sparschuh in seinem Roman KopfSprung ironisierend an einem Beispiel darstellte: Aus Goethes „Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner Brust“ wurde über „Zwei Bewußtseine wohnen, ach, in meiner Brust“ und „Zwei Bewußtseine existieren in meinem Kopf“ schließlich „Ein widersprüchliches Bewußtsein existiert in meinem Kopf“. In den vorgestellten Texten geht es um den Wissenschaftsbetrieb und das Wissenschaftsmilieu in der DDR. In den Texten werden Konflikte entfaltet und Figurencharaktere entwickelt, die erzählerische Haltung ist mit Fiktionalisierung oder faktualem Erzählen verbunden, in denen subjektive Wahrheit zu erkennen ist. Trotz der Verfremdung und der Notwendigkeit, literarische Verfahren wie Ironisieren, Allegorisieren und Typisieren zu durchschauen, ist die DDR-Belletristik eine wichtige, vor dem Buch von Peer Pasternak bisher unzureichend genutzte Quelle für zeithistorische Informationen.
Aus seinem Buch traf Peer Pasternack im Vortrag eine Auswahl aus den chronologisch angeordneten Autoren und betonte insbesondere die Werke von Helga Königsdorf, Christoph Hein, Erik Neutsch und John Erpenbeck. Einleitend erwähnte er die ideologisierende Sprachregelung in der DDR, die Jens Sparschuh in seinem Roman KopfSprung ironisierend an einem Beispiel darstellte: Aus Goethes „Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner Brust“ wurde über „Zwei Bewußtseine wohnen, ach, in meiner Brust“ und „Zwei Bewußtseine existieren in meinem Kopf“ schließlich „Ein widersprüchliches Bewußtsein existiert in meinem Kopf“. In den vorgestellten Texten geht es um den Wissenschaftsbetrieb und das Wissenschaftsmilieu in der DDR. In den Texten werden Konflikte entfaltet und Figurencharaktere entwickelt, die erzählerische Haltung ist mit Fiktionalisierung oder faktualem Erzählen verbunden, in denen subjektive Wahrheit zu erkennen ist. Trotz der Verfremdung und der Notwendigkeit, literarische Verfahren wie Ironisieren, Allegorisieren und Typisieren zu durchschauen, ist die DDR-Belletristik eine wichtige, vor dem Buch von Peer Pasternak bisher unzureichend genutzte Quelle für zeithistorische Informationen.
Diese Erkenntnis wurde im Vortrag durch die Ausführungen des Referenten bekräftigt, zum Beispiel zum Brechen des Bildungsprivilegs am Beispiel von Einmal Karthago und zurück (1975) von Egon Günther, zur Darstellung des Planens der Forschung bei Dieter Noll (1979), Helga Königsdorf (1988), Franz Fühmann (1981) und zur Genetikdebatte in vier literarischen Werken.
Im Anschluss an den Vortrag kam es zu einer regen und fundierten Diskussion, in der insbesondere der Beitrag von John Erpenbeck, dessen Werke selbst zum Gegenstand des Vortrags gehörten, sehr anregend und wichtig war. So mancher der Teilnehmenden wurde an frühere Lektüren erinnert und fühlte sich vielleicht auch angeregt, diese auf einem neuen Zeithorizont zu wiederholen.
Gerda Haßler