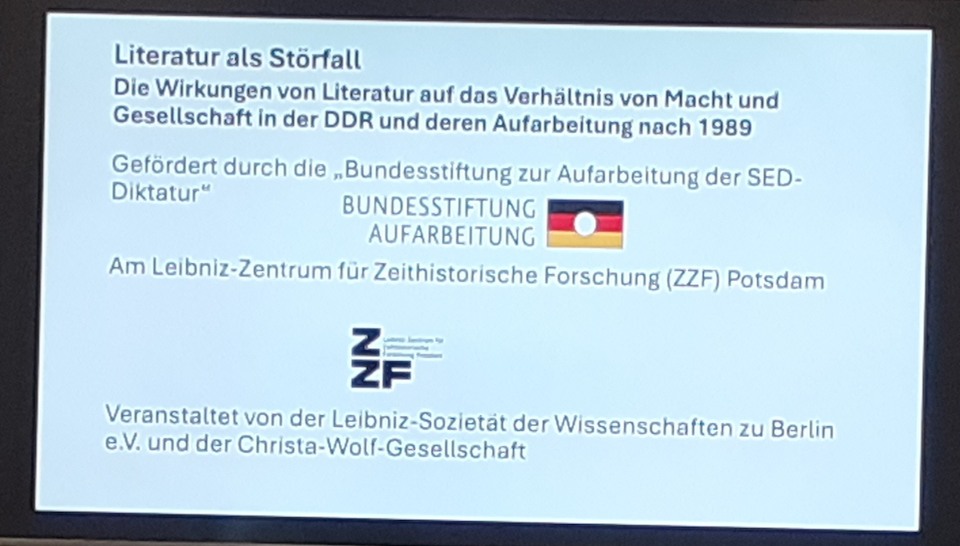Bericht über die Tagung „Literatur als Störfall“
Dieter Segert
Bericht über die Tagung „Literatur als Störfall. Die Wirkungen von Literatur auf das Verhältnis von Macht und Gesellschaft in der DDR und deren Aufarbeitung nach 1989“
Die Tagung wurde von Leibniz-Sozietät und Christa-Wolf-Gesellschaft gemeinsam organisiert. Sie fand mit umfangreicher finanzieller Unterstützung der Bundesstiftung Aufarbeitung und großzügiger logistischer Unterstützung des Leibniz Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam am 6. und 7. Oktober statt und war – gemessen an den Reaktionen der Teilnehmenden – ein voller Erfolg. Sie brachte Literaturwissenschaftler und Sozialwissenschaftler aus verschiedenen Ländern, u.a. der Niederlande, Italiens, den USA und Deutschland zusammen mit Praktikern der Kultur, einem Intendanten, Steffen Mensching, Verlagsgründer (Christoph Links) oder dem Theaterkritiker Gunnar Decker. Da es um die Wirkung der Literatur auf die Gesellschaft ging, war es auch wichtig, dass Experten mit verschiedenen Positionen in der späten DDR teilnahmen, so Klaus Wolfram ein prominenter DDR-Oppositioneller (Akteur des „Neuen Forum“), Aram Radomski, der die Leipziger Montagsdemo am 9.10. abfilmte und für deren öffentliche Kenntnisnahme sorgte, oder Bernd Pawlowski, damals Chef der Volkspolizei im Bezirk Leipzig. An ihr nahmen 30 Teilnehmende, v.a. Akademiker, aus Berlin, Potsdam und weiteren Städten teil. Unter den Teilnehmenden war eine ehemalige Vizepräsidentin des Bundestages von der Partei „Die Linke“, eine ehemalige Generalsekretärin der FDP sowie ein früherer Minister der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Die Diskussion war stets sachlich, auch dann, wenn unterschiedliche Positionen aufeinander trafen.
Carsten Gansel unterstrich in seinem Referat, dass die Literatur der DDR auf neuartige gesellschaftliche Strukturen, etwa die Brechung des Bildungsprivilegs und Umbrüche im wirtschaftlichen Alltag, reagierte und sich daher in den Gegenständen und den „Helden“ der literarischen Werke von der Literatur in der Bundesrepublik unterschied. Außerdem dominierten in verschiedenen Phasen der Literatur verschiedene Modelle und Leitmuster.
In besonderem Maße wurden die Schriftsteller und ihre Werke aus der Zeit der siebziger und achtziger Jahre in den Beiträgen behandelt. Dabei standen v.a. die Schriftsteller, die sich mit den humanistischen Zielen des Sozialismus identifizierten, wie etwa Heiner Müller, Christa Wolf, Volker Braun, sowie ihre Probleme mit der repressiven Phase der Politik seit der Biermannausbürgerung 1976 im Mittelpunkt vieler Beiträge. Der Theaterkritiker Gunnar Decker berichtete auf die Vorbereitung der sozialistischen Gesellschaften auf die Reformen Gorbatschows durch die Schriftsteller. Die Perestroika, so seine These, bewirkte die Zivilisierung einer immer noch militarisierten Gesellschaft – auch wenn sie ihre ursprünglichen Ziele nicht erreichte.
Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz war die Vermittlung eines Modells der politischen Macht in der DDR, das es ermöglichte, die Wirkung von kritischer Literatur und ihrer Rezeption durch Teile der Leserschaft auf das Entstehen einer kritischen Öffentlichkeit zu erfassen. Anhand der Analyse von Reformprozessen in den staatssozialistischen Ländern (des Tauwetters nach Stalins Tod, der Wirtschaftsreformen der 1960er Jahre, des „Prager Frühlings“ oder der sowjetischen Perestroika) wurde ein dreigliedriges Modell der politischen Macht und ihrer Veränderung im Beitrag von Dieter Segert entwickelt. Eine zentrale Rolle spielte dabei die den sozialistischen Idealen verpflichtete „Dienstklasse“, eine These, die in der Diskussion mehrfach aufgegriffen aber auch hinterfragt wurde. Die engagierte Tätigkeit von kritischen Vertretern der „Dienstklasse“ hätten eine schrittweise Zivilisierung der Diktatur erzeugt, die allerdings durch die Herrschenden wiederholt in Frage gestellt wurde.
Auf der Tagung wurde auch ein kritischer Blick auf die 1990er Jahre und den damaligen Umgang mit den Schriftstellern, die sich mit dem humanistischen Ziel des Sozialismus identifizierten, geworfen. In der polarisierten Kultur der 1990er Jahre seien viele in der DDR geschätzte Schriftsteller boykottiert worden. Das betraf besonders jene, die eine interne Opposition innerhalb der mit dem Staat verflochtenen Intelligenz dargestellt hätten. Heute jedoch habe sich in der deutschen und internationalen Germanistik ein tieferes Verständnis für jene Haltung von Schriftstellern zur DDR, in der Affirmation und Widerstand miteinander verschränkt gewesen seien, herausgebildet.
In Podiumsgesprächen wurde, erstens, über die Einsichten und Verhaltensweisen gesprochen, die in den letzten Jahren der DDR entwickelt wurden und nach 1990 produktiv eingesetzt werden konnten, sowie, zweitens, über Leistungen der DDR-Theater in den 1980er Jahren und deren Wirkung auf das Publikum.
Die Ergebnisse der Tagung sollen 2026 als Buch veröffentlicht werden.